Gleicher Job, unterschiedlicher Lohn – ein Thema, das nicht neu ist, aber dennoch aktueller denn je.
Der Arbeitsmarkt wandelt sich und es werden händeringend Fachkräfte gesucht. Ein Aspekt bleibt dahinter jedoch oft unbeachtet, nämlich die ungleiche Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Wer denkt, das sei längst Geschichte, irrt. Der sogenannte Gender Pay Gap besteht weiterhin – und das in allen Bundesländern, in nahezu allen Branchen und bei vergleichbaren Qualifikationen.
Besonders vor dem Hintergrund der stetig steigenden Lebenshaltungskosten rückt die Frage nach einer fairen Entlohnung in der Gesellschaft wieder stärker in den Fokus. Doch wie groß ist die Lücke heutfe tatsächlich und was sind die Gründe?
Der aktuelle Stand: Zahlen, die nicht überraschen
Laut dem Statistischen Bundesamt verdienten Frauen im Jahr 2023 im Durchschnitt 18 Prozent weniger Bruttostundenlohn als Männer.
Dieser sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap berücksichtigt alle Beschäftigten – also unabhängig von Position, Branche oder Arbeitszeitmodell. Er zeigt damit ein strukturelles Gesamtbild. Bei dem bereinigten Wert, der vergleichbare Tätigkeiten und Qualifikationen berücksichtigt, lag die Lücke noch immer bei sechs Prozent. Diese Differenz fällt geringer aus, bleibt aber signifikant. Sie zeigt die Unterschiede in der Bezahlung selbst dann, wenn die formalen Voraussetzungen gleich sind.
In Berlin liegt der unbereinigte Wert laut regionalen Erhebungen zum Beispiel bei elf Prozent. Die Hauptstadt steht damit besser da als der Bundesdurchschnitt, doch eine echte Lohngleichheit wird auch hier nicht erreicht.
Hilfreich für diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Job mit fairen Gehaltsstrukturen sind, sind moderne Jobportale. Wer beispielsweise gezielt nach Stellenangebote in Berlin sucht, kann über Plattformen wie HeyJobs dank der fortschrittlichen Job-Matching-Technologie schnell die passende Stellen finden – häufig sogar ohne klassischen Lebenslauf. Für Berlin stehen dort mehrere tausend Angebote bereit, filterbar nach Arbeitszeiten, Beschäftigungsarten und Qualifikationen.
Warum der Unterschied bestehen bleibt
Die Ursachen der Gender Pay Gaps sind vielfältig – und lassen sich nicht mit einem einzigen Stichwort erklären.
Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, insbesondere aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen. Sie sind außerdem vor allem in den Berufen überrepräsentiert, die gesellschaftlich wichtig, aber schlechter bezahlt sind, wie im Sozialwesen, in der Pflege oder in der Bildung.
Darüber hinaus erreichen Frauen seltener Führungspositionen. Selbst bei einer identischen Qualifikation und Berufserfahrung steigen Männer im Schnitt schneller auf. Hinzu kommt: Frauen verhandeln ihre Gehälter weniger offensiv oder erhalten seltener leistungsbezogene Boni – ein Phänomen, das auch durch Studien zur Lohnpsychologie bestätigt wird.
Ein weiterer Aspekt liegt in der Branchenwahl. Männer arbeiten überdurchschnittlich häufig in technisch orientierten, höher vergüteten Sektoren. Frauen sind im Vergleich dazu in Dienstleistungsberufen stark vertreten. Diese strukturelle Aufteilung des Arbeitsmarkts trägt zur Lohnlücke bei, unabhängig von ihrer individuellen Leistung.
Was bewegt sich bei dem Thema aktuell?
Seit 2017 haben Beschäftigte in größeren Unternehmen Anspruch auf Informationen zur Bezahlung von Kolleg:innen in vergleichbaren Positionen. Dieses Recht auf Auskunft ist im Entgelttransparenzgesetz verankert.
Die Wirkung davon zeigt sich allerdings bisher begrenzt. Laut einer Evaluation durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend machen nur wenige Beschäftigte von diesem Recht Gebrauch. Die Gründe reichen von Unsicherheit bis hin zu der Furcht vor Nachteilen.
Positiv ist: In tarifgebundenen Betrieben und im öffentlichen Dienst fällt die Gender Pay Gap deutlich kleiner aus. Auch die zunehmende Offenlegung von Gehaltsspannen in Stellenanzeigen kann langfristig zu mehr Vergleichbarkeit führen.
Dennoch: Der bereinigte Unterschied von sechs Prozent besteht weiterhin. Das zeigt, dass die Lücke nicht allein auf äußere Faktoren zurückzuführen ist. Es braucht damit mehr als Transparenz – es braucht gezielte Veränderungen in der Bewertung von Tätigkeiten, im Zugang zu Karrierewegen und auch in der Unternehmenskultur.













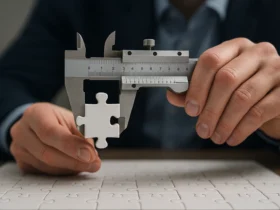


Eine Antwort hinterlassen